 Wir denken meistens, dass die Entwicklung der Frucht – aller Früchte – mit der Blüte beginnt. Doch sie setzt viel früher ein, nämlich dann, wenn sich der Fruchtbaum, in unserem Fall der Zitrusbaum, dazu entschliesst, normale Blattknospen in Blütenknospen umzuwandeln. Diese entwickeln sich dann – für uns (fast) unsichtbar – weiter, so dass die Blütentriebe und -organe in Miniaturform bereits weitgehend angelegt sind, lange bevor die Blüten für uns sichtbar erscheinen. Wenn wir also über die Fruchtbarkeit oder Nicht-Fruchtbarkeit von Obstbäumen – und hier speziell von Zitrusbäumen – sprechen, müssen wir genau hier ansetzen: Wann und wo entstehen die Zitrusblüten?
Wir denken meistens, dass die Entwicklung der Frucht – aller Früchte – mit der Blüte beginnt. Doch sie setzt viel früher ein, nämlich dann, wenn sich der Fruchtbaum, in unserem Fall der Zitrusbaum, dazu entschliesst, normale Blattknospen in Blütenknospen umzuwandeln. Diese entwickeln sich dann – für uns (fast) unsichtbar – weiter, so dass die Blütentriebe und -organe in Miniaturform bereits weitgehend angelegt sind, lange bevor die Blüten für uns sichtbar erscheinen. Wenn wir also über die Fruchtbarkeit oder Nicht-Fruchtbarkeit von Obstbäumen – und hier speziell von Zitrusbäumen – sprechen, müssen wir genau hier ansetzen: Wann und wo entstehen die Zitrusblüten?
Eine sehr alte Theorie besagt: Blüten entstehen als Stressreaktion, wenn der Baum gezwungen ist, für sein Überleben zu sorgen und möglichst schnell Nachkommen zu erzeugen. Diese Theorie greifen wir im nächsten Abschnitt auf, bevor wir uns Schritt für Schritt dem inneren Geschehen im Zitrusbaum nähern. Daraus ergeben sich viele, oft überraschende Folgerungen für die Zitruskultur nördlich der Alpen.
Inhaltsverzeichnis
- Eine alte Geschichte: Die Drohung mit der Axt und der verängstigte Zitrusbaum
- Wann bilden Zitrusbäume ihre Blüten aus?
- Blütenknospendifferenzierung und Blüte bei Fruchtbäumen aus gemässigtem Klima
- Blütenknospendifferenzierung und Blüte beim Granatapfel
- Und wann differenzieren Zitrusbäume ihre Blütenknospen?
- Wo entstehen die Blütenknospen der Zitrusbäume?
- Die Ausnahmen von dieser Regel
- Ausnahme: Dauerblüher wie Lunario-Zitronen
- Ausnahme: Blüte nach einer Trockenphase
- Ausnahme: Alternanz (auf ein Ertragsjahr folgt ein Jahr ohne Ertrag)
- Massnahmen gegen die Alternanz bei Zitrusbäumen
- Folgen für die Zitruskultur nördlich der Alpen
- Pflanzen gut in den Herbst und über den Winter bringen
- Umgang mit den Importbäumen aus dem Süden, aus Italien, Sizilien und Spanien
- Die lange Reifezeit der Zitronen, Orangen, Mandarinen und Kumquat
- Folgerungen fürs Umtopfen
- Folgerungen für das Schneiden von Zitrusbäumen
- Hat der Zitrusbaum wirklich Angst, wenn er Blüten differenziert?
Zusammenfassung
In diesem ausführlichen Beitrag wird erklärt, wie, wann und wo Zitrusbäume ihre Blütenknospen bilden, und welche praktischen Konsequenzen das für die Zitruskultur in kühleren Klimazonen – insbesondere nördlich der Alpen – hat.
Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass die Blütenbildung nicht mit der sichtbaren Blüte beginnt, sondern bereits Monate vorher, meist im Winter, durch die Differenzierung vegetativer Knospen. Zitrusbäume, ursprünglich aus subtropischen Regionen stammend, nutzen diese Ruhezeit, um sich auf die nächste Saison vorzubereiten – sofern sie kühl, hell und gut ernährt überwintern.
Der Text erklärt auch:
- Welche Rolle Stressfaktoren (Kälte, Trockenheit) spielen – und warum die Theorie von der «Angstblüte» zwar anschaulich, aber zu kurz gegriffen ist.
- Wie Ausnahmen wie Dauerblüher oder Trockenphasenblüte funktionieren.
- Was Alternanz bedeutet (Fruchtjahre verhindern Blütenknsopendifferenzierung – der nächstjährige Ertrag fällt aus) – und wie man sie durch gezielte Pflege und Ernte vermeiden oder abmildern kann.
Für die Praxis nördlich der Alpen ergeben sich daraus klare Empfehlungen:
- Überwinterung kühl und hell durchführen.
- Schnittmassnahmen vorsichtig und gezielt anwenden, insgesamt weniger schneiden, kein Bubikopfschnitt
- Umtopfen idealerweise im späten Winter, nicht im Frühjahr.
- Südliche Importpflanzen brauchen eine Phase der Eingewöhnung in einen natürlichen Rhythmus.
Eine alte Geschichte: Die Drohung mit der Axt und der verängstigte Zitrusbaum
Die ultimative «Medizin» gegen nicht blühende Obstbäume beschreibt der arabische Agronom Ibn al-Awam bereits vor 900 Jahren in seinem Buch über Landwirtschaft. Ich zitiere hier meine eigene Nacherzählung, wie sie in unserem Gartenbuch unter dem Titel «Die Drohung mit der Axt» bereits veröffentlicht wurde:
Ein Zitrusbaum, der längst hätte fruchten sollen, trägt immer noch keine Früchte. Alles agronomische Wissen, alle bekannten Kunstgriffe waren vergeblich. Was tun?
Ibn al-Awam schlägt vor: Zwei Männer nähern sich mit einer Axt dem fruchtlosen Baum. In Hörweite des unbotmässigen Baums sagt der eine:
«So, jetzt schlage ich diesen Baum um!»
Der andere entgegnet empört: «Das kannst du doch nicht machen – was hat der Baum denn verbrochen?»
«Er trägt keine Früchte. Noch nie hat er Früchte getragen. Ich habe die Geduld verloren.»
Der «Anwalt» des Baums versucht, ihn zu retten: «Warte noch ein Jahr. Wenn er dann immer noch keine Früchte trägt, darfst du ihn fällen.»
Und siehe da: Im nächsten Jahr blüht der Baum aufs Schönste.
Natürlich fragt man sich, ob Fruchtbäume – in unserem Fall Zitrusbäume – Angst haben müssen, um Blüten und damit Früchte anzusetzen. Doch bevor wir das beantworten, schauen wir uns an, wie, wann und wo bei Zitrusbäumen die Blüten tatsächlich entstehen.
Wann bilden Zitrusbäume ihre Blüten aus?
Die Hauptblüte zeigt sich bei den meisten Sorten und Arten im Frühling, wenn die Pflanze aus ihrem ruhigen Winterschlaf erwacht. Nördlich der Alpen ist das meist etwas später – im April und Mai.
Doch: Die sichtbare Blüte ist nur das Ergebnis von Prozessen, die deutlich früher stattfinden. Diese allgemeine Aussage, also die zeitliche Trennung von Blütenknsopendifferenzierung und der Ausfaltung von sichtbaren Blüten gilt für fast alle holzigen, fruchttragenden Pflanzen.
Um den Prozess, aber auch die Unterschiede zwischen verschiedenen Fruchtarten deutlicher zu machen, beginnen wir mit unseren bekannten Obstarten wie Apfel und Birne, kommen dann auf die südlichen Granatäpfel zu sprechen, um schliesslich die Umsetzung des gleichen Prozesses bei den Zitrusarten zu beschreiben.
Blütenknospendifferenzierung und Blüte bei Fruchtbäumen aus gemässigtem Klima
Fast alle Fruchtgehölze haben in ihrer Evolution gelernt, dass es riskant ist, die Blütenknospen sofort während des Wachstums zu bilden. Stattdessen wird zuerst der Trieb ausgebildet, erst später – auf Basis äusserer Signale – werden Blüten differenziert. Und nochmals später erscheinen die Blüten, möglichst genau zum richtigen Zeitpunkt, der die ungestörte Entwicklung der Früchte und Samen ermöglicht.
Beispielsweise entstehen bei Obstgehölzen der gemässigten Zonen – bei Äpfel, Birnen und Co – die Blütenknospen meist bereits im Juli bis September. Hemmstoffe verhindern einen zu frühen Austrieb, denn solche Blüten würden bis zum Herbst keine reifen Früchte mehr hervorbringen. Diese Hemmstoffe werden dann über den Winter abgebaut – im Frühjahr öffnet sich schliesslich das Blütenfenster …
Natürlich gibt es Ausnahmen, die auch im Gartenbau und in der Landwirtschaft genutzt werden: Die Herbsthimbeeren, neuerdings auch die Herbstbrombeeren, die an den diesjährig wachsenden Trieben fruchten. Auch die Herbstfeigen entstehen sofort am neu wachsenden Trieb – aber sie laufen halt auch Gefahr, nicht mehr reif zu werden. Sehr wahrscheinlich haben das die Feigen in einem Klima gelernt, das weit besser ist als das unsere.
Blütenknospendifferenzierung und Blüte beim Granatapfel
Ein anderes Beispiel, dieses Mal eine südliche, in den Subtropen bis Tropen entstandene Pflanze: Die Granatäpfel. Sie differenzieren ihre Blüten im Frühling oder Frühsommer, nur 30 – 60 Tage vor der Blüte. Dabei reagieren sie sensibel auf die aktuellen inneren und äusseren Signale – und entscheiden unter anderem:
- A) ob sie überhaupt Blüten anlegen,
- B) ob sie nur funktional männliche Blüten bilden,
- C) oder ob sie männliche und weibliche Blüten kombinieren.
Es ist schier unglaublich, wie differenziert dieser Prozess ist und wieviele Signale für die entsprechenden Pflanzenentscheidungen verarbeitet werden.
Bild: Granatapfelblüten
Und wann differenzieren Zitrusbäume ihre Blütenknospen?
Zitruspflanzen – ursprünglich subtropisch – differenzieren ihre Blütenknospen im Winter, etwa 3 bis 4 Monate vor der Blüte. In dieser Zeit reduzieren sie ihren Stoffwechsel bei Temperaturen zwischen 2 und 15 °C und bereiten sich ruhig, aber gezielt, auf die kommende Saison vor.
Warum gerade im Winter?
Man könnte vermuten, dass die Pflanzen – ganz im Sinne Ibn al-Awams – «Angst» vor dem Winter haben. Doch realistischer ist: Zitruspflanzen sind evolutionär so programmiert, dass der Winter der ideale Zeitpunkt für die Blütendifferenzierung ist. Die Früchte des Vorjahres sind geerntet (?), neues vegetatives Wachstum ist nicht nötig – also kann die Energie in die Bildung von Blütenknospen fliessen. Als immergrüne Pflanzen produzieren Zitrussorten ja auch im Winter genügend Energie dafür.
Wo entstehen die Blütenknospen der Zitrusbäume?
Die Blütenknospen entstehen – wie gesagt – im Spätherbst bis Frühwinter am ausgereiftem Holz des laufenden Jahres. Wenn also im Frühjahr die Blüten physisch sichtbar erscheinen, stammen sie vom Trieb des Vorjahres, der im Spätherbst zur Ruhe kam.
Bild: Viele Blüten haben sich an den Triebspitzen dieser winterharten Ichang Papeda gebildet.
Die Ausnahmen von dieser Regel
Natürlich gibt es, wie immer in der Natur, auch Ausnahmen von dieser Regel, die wir im folgenden kurz auflisten.
Ausnahme: Dauerblüher wie Lunario-Zitronen
Einige Sorten, wie etwa die Zitrone 'Lunario', blühen fast ganzjährig. Diese Sorten wurden gezielt auf Dauerblühfähigkeit selektiert – oder stammen aus tropischen Regionen ohne ausgeprägte Winterruhe.
Bild: Früchte und Blüten der dauerblühenden Zitronensorte 'Lunario'
Ausnahme: Blüte nach einer Trockenphase
Viele Zitrussorten haben auch die Fähigkeit, nach einer echten oder künstlich induzierten Trockenphase von 4 – 6 Wochen Blüten zu entwickeln. Auch diese Fähigkeit haben sie sich wahrscheinlich bei ihrer Weiterentwicklung in tropischen Regionen angeeignet. Letztlich ist aber der Prozess ein ganz ähnlicher wie bei der Winter-Blütendifferenzierung. Die Pflanze spürt natürlich die Trockenheit und reagiert darauf. Sie reduziert ihre Atmung, ihren Stoffwechsel, schliesst die Stomata und geht automatisch in einen Ruhemodus über, der Energie spart. Dennoch produziert der Zitrusbaum genügend Energie, um genau in dieser Stressphase Blüten zu differenzieren. Wenn dann der Monsun einsetzt, oder wenn die Kulturpflanzen wieder ordentlich gewässert werden, kommen die Blüten mitten im Sommer zum Vorschein.
Diesen Effekt haben wir übrigens immer wieder bei Kumquat beobachtet. Selbstverständlich kann dieser Prozess auch in der Zitruskultur nördlich der Alpen künstlich herbeigeführt werden, indem man weitgehend auf die Bewässerung verzichtet und allenfalls die Zitrusbäume unter ein schützendes regenabweisendes Vordach stellt. Dabei ist natürlich auch darauf zu achten, dass der Stress nicht zu gross wird. Während im gewachsenen Boden noch sehr lange etwas Waser aufzufinden ist, ist dies in einem Topf nicht möglich. Wenn sich die Blätter zu rollen beginnen und Trockenheitsstress zeigen, muss also leicht nachgewässert werden. Nach 4 – 6 Wochen ist es dann so weit, und der Zitrusgärtner wechselt wieder auf regelmässige Bewässerung – und kann dann hoffen, dass die Blüte beginnt. Allerdings ist zu beachten, dass diese Massnahme auch Konsequenzen hat. Die so entstehenden Früchte haben keine Chance, noch im gleichen Jahr oder im frühen Frühjahr reif zu werden. Damit ist der natürliche Rhythmus der Zitruspflanzen gestört und auch in den Folgejahren ist nicht mit einer Blüte im Frühjahr zu rechnen – sowieso nicht bei jungen Bäumen.
Ausnahme: Alternanz (auf ein Ertragsjahr folgt ein Jahr ohne Ertrag)
Wie auch Apfelbäume unterliegt der Fruchtertrag von Zitrusbäumen einer natürlichen Schwankung: Ein Jahr mit hoher Fruchtlast kann das folgende Blütenjahr (und auch den zukünftigen Ertrag) schwächen. In der Folge wechseln sich Jahre mit sehr hohen Erträgen mit Jahren fast ohne Früchte ab. Diese Alternanz entsteht durch hormonelle Signal- und Botenstoffe, die in den reifenden Samen gebildet werden und die Blütenbildung hemmen.
Sorten ohne Samen (z. B. Clementinen) sind von diesem Effekt weniger betroffen.
Massnahmen gegen die Alternanz bei Zitrusbäumen
Gegen die Alternanz können folgende Massnahmen ergriffen werden:
- Ausdünnen: Zu viele Früchte pro Trieb sollten reduziert werden. Z.B. werden alle Blütenbüschel auf nur eine stehendbleibende Frucht reduziert. Das Ausdünnen hat möglichst früh zu erfolgen, wenn die Früchte ca. nussgross sind.
- Früchte rechtzeitig ernten: Um die hemmenden Reifesignale zu verkürzen, sollen reife Früchte so schnell wie möglich geerntet werden. Also eher nicht möglichst lange hängenlassen, um bei jedem Gartenspaziergang einen Snack zu ernten …
- Geduld zeigen: Alternanz ist nicht immer vermeidbar – der nächste Herbst bringt wieder neue Fruchtholztriebe, die dann im Winter neue Blütenknospen differenzieren.
Folgen für die Zitruskultur nördlich der Alpen
Aus dem neuen Wissen über die Blütendifferenzierung bei Zitrusbäumen ergeben sich ein paar allgemeine Folgerungen für die Zitruskultur nördlich der Alpen.
Pflanzen gut in den Herbst und über den Winter bringen
Dies ist letztlich für die Blüte im nachfolgenden Frühjahr das Wichtigste. Eine gut ernährte und dann sachgerecht (kühl und hell) überwinterte Zitruspflanze wird über den Winter zuverlässig Blüten fürs nächste Frühjahr differenzieren. Wenn die Pflanze schon im Herbst schwach ist, einen Teil der Blätter verloren hat oder im Winter an Staunässe leidet (zu viel Wasser), hat die Zitruspflanze kaum die Energie, in Blüten und damit in die Zukunft zu investieren. Mit am schlimmsten ist wahrscheinlich eine zu warme Überwinterung: Die Zitruspflanze kennt diese Kombination von wenig Licht und sommerlichen Temperaturen nicht und ist vollkommen «verwirrt». Soll sie jetzt wieder zu wachsen beginnen? Aber woher soll bei so wenig Licht die dafür notwendige Energie kommen? Ganz sicher wird eine so «verwirrte» Pflanze keine Blütenknospen differenzieren.
Umgang mit den Importbäumen aus dem Süden, aus Italien, Sizilien und Spanien
Die Zitruspflanzenproduzenten in Spanien und in Sizilien haben sich drauf spezialsiert, ihre Verkaufspflanzen (für den Frühling im Norden) so vorzubereiten, dass sie voll von Früchten und / oder von Blüten sind. Dies geschieht auch mit dem gezielten Einsatz von Pflanzenhormonen, die wir bei uns im Garten nicht einsetzen können. Gleichzeitig werden die Bäumchen wie Ziergehölze rund geschnitten, sodass sie schön aussehen – aber ohne neues Holz kann es auch keine zukünftigen Blüten geben. Die Käufer müssen also damit rechnen, dass wir die Pflanzen bei uns erst in einen neuen Rhythmus bringen müssen. Wir ernten die Früchte so schnell wie möglich, düngen gut und erzielen so einen schönen Zuwachs an neuen Trieben, die idealerweise schon im nachfolgenden Spätherbst im Inneren ihrer Knospen Blüten differenzieren. Stärker vegetative Bäumchen, wie die Switrus Zitrusbäumchen, die in unseren eigenen Lubera®-Baumschulen produziert werden, haben den Vorteil, dass sie im Verkaufsfrühjahr keine Früchte tragen und damit der Alternanz weniger ausgesetzt sind. Entweder blühen sie schon im April oder Mai in unserem Klima und kommen damit in einen natürlichen Rhythmus – oder die erste Blütenknospendifferenzierung folgt im Herbst des gleichen Jahres.

Bild: Zitruspflanzen aus Südeuropa mit Bubikopfschnitt
Die lange Reifezeit der Zitronen, Orangen, Mandarinen und Kumquat
Die bestehenden Zitrussorten sind nicht für unser Klima, sondern für die südliche Vegetationsperiode (länger, mehr Licht, mehr Wärme) ausgelesen worden. Häufig oder eher fast immer werden sie nicht zeitig im Herbst oder Frühwinter reif – und entwickeln ihre Früchte erst nach der Ueberwinterung zu Ende. Dies fördert die Alternanz und kann auch dazu führen, dass wir nur alle zwei Jahre mit einer guten Ernte rechnen können. Bei sehr frühreifenden Sorten und mit samenlosen Zitrusarten kann man teilweise diesem Problem entkommen
Folgerungen fürs Umtopfen
Oft wird empfohlen, Zitruspflanzen im Frühjahr umzutopfen – besser ist ein Zeitpunkt zwischen Blütendifferenzierung (Spätherbst) und Vegetationsstart (Februar / März). Zu spätes Umtopfen stört die Blütenentwicklung. Gleich fragwürdig ist der Bubikopfschnitt, der häufig beim Umtopfen angewendet wird, um dem Zitrusbaum eine schöne Zierform zu geben: Damit werden hauptsächlich die letztjährigen Treibe entfernt, die gegen die Triebspitze hin am meisten Blütenknospen differenziert haben. Diese sind aber zum Zeitpunkt des Umtopfens leider noch nicht sichtbar …
Damit wären wir aber schon beim Thema des Schneidens angelangt.
Folgerungen für das Schneiden von Zitrusbäumen
Ich bin überzeugt davon, dass wir in unserem Klima die Zitrusbäume zu stark schneiden. Dabei ist der Zusammenhang ja sonnenklar: Wenn es keine oder nur wenige neue Triebe bleiben, dann fällt auch die Blütendifferenzierung aus (oder die neuen Triebe mit schon differenzierten Blütenknospen werden weggeschnitten), in der Folge gibt es weniger Blüten und weniger Früchte. Dazu kommt, dass die Blüten tendenziell eher am Ende der Triebe (mit Vorzug der mittellangen Treibe) entstehen. Wir behandeln bei uns Zitrusgehölze zu sehr als Ziergehölze und wollen den Habitus einer wunderschönen Kronenkugel voll von Früchten erhalten, so wie die Bäume aus dem Süden zu uns kommen und verkauft werden.
Also gilt es, weniger zu schneiden
Was bedeutet aber «weniger schneiden»?
- Der bekannte Bubikopfschnitt auf eine Kronenkugel darf im Herbst oder im Frühjahr nicht erfolgen, sonst schneiden wir die Blütenanlagen weg.
- Beachtet bitte auch, dass die Blüten meist eher am Ende der letztjährigen (vor allem mittellangen) Triebe differenziert werden; wenn wir alles entspitzen, so entfernen wir in Tat und Wahrheit die Blütenanlagen und damit die zukünftigen Früchte.
- Wir sollten vor allem ältere Triebe schneiden, die schon Früchte getragen haben. Diese werden stark oder bis auf einen Stummel eingekürzt, um neues Trieb-Wachstum anzuregen
- Auslichtungsschnitt: allenfalls können über die Krone stark hinausregende lange Äste entfernt oder eingekürzt werden. Dies hat auch einen langfristigen Effekt: die lockere Krone ist lichtdurchlässiger und kann das bei uns reduzierte Sonnenlicht besser einfangen. Eine zu dichte Krone (und die aus dem Süden stammenden Pflanzen verfügen meist über eine sehr dichte Krone) beschattet sich selber zu stark.
Video: In diesem Video erfährst du, wie man Zitrusgehölze richtig schneidet.
Hat der Zitrusbaum wirklich Angst, wenn er Blüten differenziert?
Eigentlich wohl nicht – und der Begriff «Angst» ist sicher der falsche. «Überlebenswillen» wäre wahrscheinlich das bessere Wort. Alles Leben hat ganz einfach gelernt, dass es sich fortpflanzen muss, wenn es erhalten bleiben soll. Und dafür warten die Zitrusbäume einfach den richtigen Zeitpunkt ab, in dem sie sich auf die Blütenknospendifferenzierung konzentrieren können. Ibn al Awam hat mit der Drohung mit der Axt ein wunderschönes Bild für die Problematik des Fruchtens / nicht Fruchtens beschrieben. Nach ihm hat die Pflanze Angst und kümmert sich endlich um ihre Fortpflanzung … und um unsere Ernte. Aber recht verstanden erzählt die Geschichte nur unsere, die menschlichen Interessen, Denkweisen und Ängste: Wir verlieren zu schnell die gärtnerische Geduld und drohen gleich mit der Axt oder – bei unserem bisherigen Verständnis der nördlichen Zitruskultur – auch viel zu häufig mit der Schere. So kann man beispielsweise fast überall (und leider fast sicher auch in unserem Gartenbuch) nachlesen, dass der starke Schnitt die Fruchtbarkeit steigere. Die Realität ist eine andere: Der Schnitt ist wichtig, um die Pflanze anzuregen, neue Äste wachsen zu lassen – die dann gegebenenfalls im Folgejahr fruchten. Der häufig praktizierte Bubikopfschnitt führt direkt zum Gegenteil.
Formulieren wir es zum Abschluss nochmals etwas pointierter: Die Angst des Zitrusbaums in der Geschichte von Ibn al Awam ist eigentlich die unsere. Unsere ungeduldige Angst, auf Früchte verzichten zu müssen, führt zu unbegründeter Aktivität, zu einem zu starken Schnitt. Der Zitrusbaum lässt sich davon gegebenenfalls beeindrucken, aber nur indem er erst recht keine Früchte produzieren wird. Abwarten und zur Not nichts machen, wäre letztlich viel besser. Aber genau das haben die beiden Zitrusbauern in der Geschichte von Ibn al Awam schlussendlich ja auch gemacht 😉







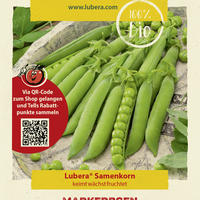







 Lubera Originale sind exklusive Lubera® Sorten, die von Lubera entweder gezüchtet oder erstmals auf den Markt gebracht worden sind.
Wer Lubera Originale kauft, bekommt die doppelten Tells®-Äpfel (=Rabatte für die nächste Bestellung) gutgeschrieben.
Lubera Originale sind exklusive Lubera® Sorten, die von Lubera entweder gezüchtet oder erstmals auf den Markt gebracht worden sind.
Wer Lubera Originale kauft, bekommt die doppelten Tells®-Äpfel (=Rabatte für die nächste Bestellung) gutgeschrieben.
 Beim Kauf dieser von Lubera gezüchteten Lubera Original-Pflanze erhalten Sie die doppelten Tells gutgeschrieben.
Tells® werden grundsätzlich aufgrund des fakturierten Nettobetrags berechnet (1 Tells für volle 25 Euro/sFr).
Bei doppelten Tells wird am Schluss nochmals der Wert der Tells-Originale dazugerechnet und die neue Summe für die Berechnung der Tells benutzt.
Beim Kauf dieser von Lubera gezüchteten Lubera Original-Pflanze erhalten Sie die doppelten Tells gutgeschrieben.
Tells® werden grundsätzlich aufgrund des fakturierten Nettobetrags berechnet (1 Tells für volle 25 Euro/sFr).
Bei doppelten Tells wird am Schluss nochmals der Wert der Tells-Originale dazugerechnet und die neue Summe für die Berechnung der Tells benutzt.